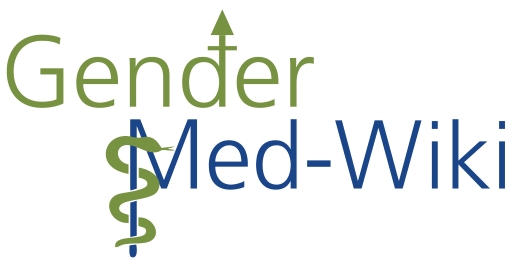Geschlecht: Unterschied zwischen den Versionen
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Medizinische Versorgung ist nicht geschlechterneutral. Dabei nimmt nicht nur das Geschlecht der zu behandelnden Person Einfluss auf den Versorgungsprozess. Entscheidend kann auch sein, ob das jeweilige Fachpersonal weiblich oder männlich ist. Studien erkennen und bestätigen einen oft unbewussten „Gender Bias“: Zum Beispiel scheinen Patienten im Vergleich zu Patientinnen mit Typ-2-Diabetes signifikant seltener eine optimale Behandlung zur Vermeidung von möglichen Folgekomplikationen zu erhalten. Zudem betreuen Ärztinnen Patienten und Patientinnen mit Typ-2-Diabetes besser und betreiben intensiver prognostisch wichtiges Präventionsmanagement als Ärzte. Ärztinnen gelingt es besser als ihren männlichen Kollegen, den Blutzuckerspiegel und den Blutlipidspiegel zu senken.<ref>Gouni-Berthold I, Berthold HK, Mantzoros CS, Böhm M, Krone W. Sex disparities in the treatment and control of cardiovascular risk factors in type 2 diabetes. Diabetes care 2008; 31(7):1389–91.</ref> Desweiteren geben Männer in Gegenwart von weiblichem Fachpersonal ein geringeres Schmerzlevel an als in Gegenwart von männlichen Versorgern. Sozial verankerte Geschlechterbilder („der starke Mann“) scheinen dabei eine Rolle zu spielen. Frauen werden bei ihren Schmerzäußerungen nicht durch das Geschlecht des Fachpersonals beeinflusst und stufen ihre Schmerzen generell höher ein als Männer.<ref>Aslaksen PM, Myrbakk IN, Høifødt RS, Flaten MA. The effect of experimenter gender on autonomic and subjective responses to pain stimuli. Pain 2007; 129(3):260–8.</ref> Dabei ist die Frage berechtigt, inwiefern Schmerz tatsächlich typisch „weiblich“ ist und wie stark das [[Das soziale Geschlecht („Gender“)|soziale Geschlecht]] Einfluss auf die Bewertungsprozesse nimmt.<ref>Kindler-Röhrborn A, Pfleiderer B. Gendermedizin - Modewort oder Notwendigkeit?: - Die Rolle des Geschlechts in der Medizin. XX 2012; 1(03):146–52.</ref> | |
| − | + | <br> | |
| − | == | + | ==Geschlechterspezifische Kommunikation== |
| − | + | Vor allem der Hausarzt oder die Hausärztin begleiten den Patienten/die Patientin häufig über viele Jahre und sind meist erste Anlauf- und Koordinationsstelle für die weitere medizinische Versorgung. Die Freiheit, den Hausarzt/die Hausärztin persönlich zu wählen (einschließlich der Wahl des Geschlechts), scheint besonders für Frauen entscheidend. Eine von vier Frauen bevorzugt es, das Geschlecht des Arztes/der Ärztin selbst zu wählen, wobei die Mehrheit eine Hausärztin bevorzugen würde. Je jünger die Patientinnen, desto eindeutiger ist diese Präferenz. Besonders bei sexuellen Problemen bevorzugen Frauen fast immer die Behandlung durch weibliches Fachpersonal. Diese geschlechtsspezifische Präferenz wird unter anderem mit einem patientInnenorientierten Kommunikationsstil erklärt, der vor allem von Ärztinnen praktiziert wird.<ref>Janssen SM, Lagro-Janssen, Antoine L M. Physician's gender, communication style, patient preferences and patient satisfaction in gynecology and obstetrics: a systematic review. Patient education and counseling 2012; 89(2):221–6.</ref> Das Geschlecht des Arztes/der Ärztin spielt also nicht nur bei den zu treffenden Entscheidungen, sondern auch bei der Kommunikation mit den Patienten und Patientinnen, eine wichtige Rolle. Während der Konsultation explorieren Ärztinnen die psychosozialen Umstände der Patienten und Patientinnen genauer, spenden dem emotionalen Zustand mehr Beachtung, treffen einen positiveren Ton, ermöglichen den Betroffenen eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und ermutigen zu mehr Teilhabe an medizinischen Entscheidungen. Ärzten wird dagegen häufig ein eher aufgabenorientierter Kommunikationsstil zugesprochen, der das Herausarbeiten der Krankheitsgeschichte, das Erklären von Diagnosen, und präzise Behandlungsstrategien beinhaltet. Ein Geschlechtereffekt in der Arzt/Ärztin-PatientIn-Beziehung lässt sich diesbezüglich aber nicht feststellen. | |
| − | == | + | <br> |
| + | |||
| + | ==Geschlechterspezifische Behandlung== | ||
| + | |||
| + | Männer und Frauen treffen zuweilen unterschiedliche Entscheidungen bezüglich Diagnose und Behandlung. Zum Beispiel führen Ärzte bei den gleichen Symptomen häufiger eine Rektaluntersuchung bei männlichen Patienten durch als ihre Kolleginnen. Dagegen nehmen Hausärztinnen im Vergleich zu Hausärzten bei Frauen eher eine Vaginaluntersuchung vor.<ref>Shires DA, Stange KC, Divine G, Ratliff S, Vashi R, Tai-Seale M et al. Prioritization of evidence-based preventive health services during periodic health examinations. American journal of preventive medicine 2012; 42(2):164–73.</ref> <ref>Lagro-Janssen, A L M. De geneeskunde is niet genderneutraal: invloed van de sekse van de dokter op de medische zorg. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2008; 152(20):1141–5.</ref> Es scheinen psychologische Barrieren zu existieren, wenn es darum geht, Patienten oder Patientinnen des anderen Geschlechts sehr persönliche Fragen zu stellen oder intime Behandlungen vorzunehmen. Das führt zuweilen dazu, dass notwendige Behandlungen nicht stattfinden, Ärzte und Ärztinnen bezüglich dieser Untersuchungen weniger erfahren sind und seltener relevante Befunde gemacht werden können. | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | Hausärzte und Internisten verschreiben häufiger und in höheren Dosen Psychopharmaka, Sedativa und Analgetika als ihre Kolleginnen (und Patientinnen bekommen diese häufiger verschrieben als Patienten).<ref>Johnell K, Fastbom J. Gender and use of hypnotics or sedatives in old age: a nationwide register-based study. International journal of clinical pharmacy 2011; 33(5):788–93.</ref> <ref>van der Waals, F W, Mohrs J, Foets M. Sex differences among recipients of benzodiazepines in Dutch general practice. BMJ (Clinical research ed.) 1993; 307(6900):363–6.</ref> Auch interpretieren Ärzte weibliche Gesundheitsbeschwerden öfter als psychosomatisch als männliche Beschwerden. Zudem verschreiben sie Frauen in der Menopause häufiger hormonelle Ersatztherapien und HIV-positiven Patienten und Patientinnen häufiger Proteaseinhibitoren als dies bei Ärztinnen zu beobachten ist. Nicht nur das Geschlecht selbst, sondern auch die aktuelle geschlechterspezifische Lebensphase kann Einfluss auf medizinische Entscheidungen ausüben. Zum Beispiel verschreiben Hausärztinnen mit menopausalen Beschwerden Patientinnen im Klimakterium deutlich häufiger hormonelle Ersatztherapien als ihre männliche Kollegen oder jüngeren Kolleginnen.<ref>The Netherlands Organisation for Health Research and Development. Gender and Health: Knowledge Agenda. Den Haag; 2015.</ref> | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | [[Modul 1: Geschlecht und Medizin | Zurück zu Modul 1: Geschlecht und Medizin]] | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
| Zeile 18: | Zeile 30: | ||
Julia Schreitmüller | Julia Schreitmüller | ||
| − | Zuletzt geändert: 2017- | + | Zuletzt geändert: 2017-10-08 15:16:05 |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2017, 15:16 Uhr
Medizinische Versorgung ist nicht geschlechterneutral. Dabei nimmt nicht nur das Geschlecht der zu behandelnden Person Einfluss auf den Versorgungsprozess. Entscheidend kann auch sein, ob das jeweilige Fachpersonal weiblich oder männlich ist. Studien erkennen und bestätigen einen oft unbewussten „Gender Bias“: Zum Beispiel scheinen Patienten im Vergleich zu Patientinnen mit Typ-2-Diabetes signifikant seltener eine optimale Behandlung zur Vermeidung von möglichen Folgekomplikationen zu erhalten. Zudem betreuen Ärztinnen Patienten und Patientinnen mit Typ-2-Diabetes besser und betreiben intensiver prognostisch wichtiges Präventionsmanagement als Ärzte. Ärztinnen gelingt es besser als ihren männlichen Kollegen, den Blutzuckerspiegel und den Blutlipidspiegel zu senken.[1] Desweiteren geben Männer in Gegenwart von weiblichem Fachpersonal ein geringeres Schmerzlevel an als in Gegenwart von männlichen Versorgern. Sozial verankerte Geschlechterbilder („der starke Mann“) scheinen dabei eine Rolle zu spielen. Frauen werden bei ihren Schmerzäußerungen nicht durch das Geschlecht des Fachpersonals beeinflusst und stufen ihre Schmerzen generell höher ein als Männer.[2] Dabei ist die Frage berechtigt, inwiefern Schmerz tatsächlich typisch „weiblich“ ist und wie stark das soziale Geschlecht Einfluss auf die Bewertungsprozesse nimmt.[3]
Inhaltsverzeichnis
Geschlechterspezifische Kommunikation[Bearbeiten]
Vor allem der Hausarzt oder die Hausärztin begleiten den Patienten/die Patientin häufig über viele Jahre und sind meist erste Anlauf- und Koordinationsstelle für die weitere medizinische Versorgung. Die Freiheit, den Hausarzt/die Hausärztin persönlich zu wählen (einschließlich der Wahl des Geschlechts), scheint besonders für Frauen entscheidend. Eine von vier Frauen bevorzugt es, das Geschlecht des Arztes/der Ärztin selbst zu wählen, wobei die Mehrheit eine Hausärztin bevorzugen würde. Je jünger die Patientinnen, desto eindeutiger ist diese Präferenz. Besonders bei sexuellen Problemen bevorzugen Frauen fast immer die Behandlung durch weibliches Fachpersonal. Diese geschlechtsspezifische Präferenz wird unter anderem mit einem patientInnenorientierten Kommunikationsstil erklärt, der vor allem von Ärztinnen praktiziert wird.[4] Das Geschlecht des Arztes/der Ärztin spielt also nicht nur bei den zu treffenden Entscheidungen, sondern auch bei der Kommunikation mit den Patienten und Patientinnen, eine wichtige Rolle. Während der Konsultation explorieren Ärztinnen die psychosozialen Umstände der Patienten und Patientinnen genauer, spenden dem emotionalen Zustand mehr Beachtung, treffen einen positiveren Ton, ermöglichen den Betroffenen eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und ermutigen zu mehr Teilhabe an medizinischen Entscheidungen. Ärzten wird dagegen häufig ein eher aufgabenorientierter Kommunikationsstil zugesprochen, der das Herausarbeiten der Krankheitsgeschichte, das Erklären von Diagnosen, und präzise Behandlungsstrategien beinhaltet. Ein Geschlechtereffekt in der Arzt/Ärztin-PatientIn-Beziehung lässt sich diesbezüglich aber nicht feststellen.
Geschlechterspezifische Behandlung[Bearbeiten]
Männer und Frauen treffen zuweilen unterschiedliche Entscheidungen bezüglich Diagnose und Behandlung. Zum Beispiel führen Ärzte bei den gleichen Symptomen häufiger eine Rektaluntersuchung bei männlichen Patienten durch als ihre Kolleginnen. Dagegen nehmen Hausärztinnen im Vergleich zu Hausärzten bei Frauen eher eine Vaginaluntersuchung vor.[5] [6] Es scheinen psychologische Barrieren zu existieren, wenn es darum geht, Patienten oder Patientinnen des anderen Geschlechts sehr persönliche Fragen zu stellen oder intime Behandlungen vorzunehmen. Das führt zuweilen dazu, dass notwendige Behandlungen nicht stattfinden, Ärzte und Ärztinnen bezüglich dieser Untersuchungen weniger erfahren sind und seltener relevante Befunde gemacht werden können.
Hausärzte und Internisten verschreiben häufiger und in höheren Dosen Psychopharmaka, Sedativa und Analgetika als ihre Kolleginnen (und Patientinnen bekommen diese häufiger verschrieben als Patienten).[7] [8] Auch interpretieren Ärzte weibliche Gesundheitsbeschwerden öfter als psychosomatisch als männliche Beschwerden. Zudem verschreiben sie Frauen in der Menopause häufiger hormonelle Ersatztherapien und HIV-positiven Patienten und Patientinnen häufiger Proteaseinhibitoren als dies bei Ärztinnen zu beobachten ist. Nicht nur das Geschlecht selbst, sondern auch die aktuelle geschlechterspezifische Lebensphase kann Einfluss auf medizinische Entscheidungen ausüben. Zum Beispiel verschreiben Hausärztinnen mit menopausalen Beschwerden Patientinnen im Klimakterium deutlich häufiger hormonelle Ersatztherapien als ihre männliche Kollegen oder jüngeren Kolleginnen.[9]
Zurück zu Modul 1: Geschlecht und Medizin
Literatur[Bearbeiten]
- Gouni-Berthold I, Berthold HK, Mantzoros CS, Böhm M, Krone W. Sex disparities in the treatment and control of cardiovascular risk factors in type 2 diabetes. Diabetes care 2008; 31(7):1389–91.
- Aslaksen PM, Myrbakk IN, Høifødt RS, Flaten MA. The effect of experimenter gender on autonomic and subjective responses to pain stimuli. Pain 2007; 129(3):260–8.
- Kindler-Röhrborn A, Pfleiderer B. Gendermedizin - Modewort oder Notwendigkeit?: - Die Rolle des Geschlechts in der Medizin. XX 2012; 1(03):146–52.
- Janssen SM, Lagro-Janssen, Antoine L M. Physician's gender, communication style, patient preferences and patient satisfaction in gynecology and obstetrics: a systematic review. Patient education and counseling 2012; 89(2):221–6.
- Shires DA, Stange KC, Divine G, Ratliff S, Vashi R, Tai-Seale M et al. Prioritization of evidence-based preventive health services during periodic health examinations. American journal of preventive medicine 2012; 42(2):164–73.
- Lagro-Janssen, A L M. De geneeskunde is niet genderneutraal: invloed van de sekse van de dokter op de medische zorg. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 2008; 152(20):1141–5.
- Johnell K, Fastbom J. Gender and use of hypnotics or sedatives in old age: a nationwide register-based study. International journal of clinical pharmacy 2011; 33(5):788–93.
- van der Waals, F W, Mohrs J, Foets M. Sex differences among recipients of benzodiazepines in Dutch general practice. BMJ (Clinical research ed.) 1993; 307(6900):363–6.
- The Netherlands Organisation for Health Research and Development. Gender and Health: Knowledge Agenda. Den Haag; 2015.
Lizenz[Bearbeiten]
Dieser Artikel ist unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Den vollen Lizenzinhalt finden Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
Autoren[Bearbeiten]
Julia Schreitmüller
Zuletzt geändert: 2017-10-08 15:16:05
Biologisches Geschlecht