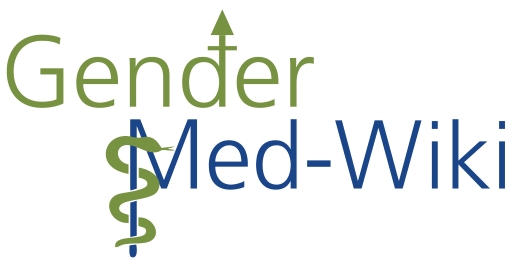Männerspezifische Gesundheitsaspekte
Inzidenz/Prävalenz[Bearbeiten]
Geschlechterbedingte Unterschiede sind bezüglich Schmerz und Schmerzstörungen wissenschaftlich belegt.[1] Frauen leiden generell häufiger unter (fast) allen Arten von Schmerzen als Männer. Sie weisen zudem eine höhere Schmerzsensitivität und eine niedrigere Schmerzschwelle auf.[2] Damit zusammenhängend werden Frauen mit einem deutlich erhöhten Risiko assoziiert, unter akut starken Schmerzen zu leiden und postoperativ anhaltende Schmerzen zu entwickeln.[3] [4] Allgemein ergeben sich signifikant höhere Prävalenzzahlen für Frauen im Vergleich zu Männern bezüglich Schmerzerkrankungen wie Migräne/Kopfschmerzen, Kraniomandibuläre Dysfunktion, Reizdarmsyndrom, rheumatoide Arthritis und Osteoarthritis. Betroffen sind vor allem Frauen in ihren reproduktiven Jahren.[5] Für viele dieser Schmerzstörungen kann belegt werden, dass Frauen öfter unter stärkeren Schmerzen leiden und Schmerzepisoden länger andauern. Typische Erkrankungen sind dabei die Fibromyalgie und das Reizdarmsyndrom. [6] [7] Beim Reizdarmsyndrom (deutlich erhöhte viszerale Sensitivität zusammen mit einer Dysfunktion des Darms) sind Frauen beispielsweise signifikant stärker in ihrem Alltag beeinträchtigt und leiden häufiger unter psychiatrischen Komorbiditäten als Männer. [8]
Risikofaktoren und protektive Faktoren[Bearbeiten]
Orientierend an Studien zu Prävalenz und Inzidenz von Schmerz und Schmerzerkrankungen[9] [10], lässt sich das weibliche Geschlecht als wichtiger Risikofaktor bezüglich der Entwicklung von Schmerzsymptomatiken identifizieren. Dabei ist von Geschlechterunterschieden in der exogenen und endogenen Modulation von Schmerz auszugehen. Mechanismen, die der geschlechterbedingten Variabilität von Schmerzantworten zugrunde liegen, werden oft entweder als biologische oder als psychosoziale Determinanten begriffen. Dieses dualistische Konzept sollte als überholt und praxisuntauglich eingeordnet und lediglich für eine Analyse auf verschiedenen Ebenen herangezogen werden. Zum Beispiel werden aus einer psychosozialen Perspektive geschlechterspezifische Schmerzäußerungen häufig allein mit stereotypen Geschlechterrollen erklärt. Biologische Aspekte werden dann als Untersuchungsgegenstand ignoriert. Wird der Einfluss geschlechterbedingter hormoneller und neurobiologischer Faktoren und deren Interaktion mit der jeweiligen Geschlechterrolle übersehen, können grundlegende Aspekte der nozizeptiven Antwort nicht verstanden werden. Welche Faktoren (soziale und/oder biologische) Geschlechterunterschiede bedingen können, ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.
| Biologische Faktoren | Psychosoziale Faktoren |
|---|---|
| Sexualhormone: Besonders während ihrer reproduktiven Jahr sind Frauen häufiger von chronischen Schmerzsyndromen betroffen als Männer.[11] Hormonelle Veränderungen während der Schwangerschaft führen dagegen zu einer erhöhten Unempfindlichkeit gegenüber Schmerzen[12] | Geschlechterrolle: Unter anderen ergeben Studien, dass Männer geringere Schmerzlevel angeben, wenn sie von einer Versuchsleiterin (und nicht um einen Versuchsleiter) versorgt werden. Konform zu ihrer Geschlechterrolle wollen sie sich schmerzunempfindlich und stark zeigen.[13] |
| Endogenes Opioid-System: Frauen scheinen im Vergleich zu Männern eine reduzierte endogene Schmerzhemmung zu besitzen.[14] | Coping und Katastrophisieren: Frauen scheinen eher katastrophisierende Gedanken zu haben, die mit einem schlechten subjektiven Gesundheitszustand korrelieren[15] und den Geschlechterunterschied von Schmerzwahrnehmung modulieren.[16] Patientinnen nutzen zur Schmerzbewältigung eher das Aufsuchen sozialer Unterstützung sowie positive Selbstbejahung, Patienten verwenden eher Ablenkungsstrategien.[17] |
| Dopamin: Östrogene und Progestine haben einen komplexen Einfluss auf die Dopamin-Fluktuation. Einige Studien bestätigen eine höhere Funktionalität des Dopamintransporters (DAT) bei Frauen.[18] Dopaminerge Geschlechterunterschiede scheinen beispielsweise die primären klinischen Symptome von Fibromyalgie erklären zu können.[19] | Affektiver Distress: Stress führt bei Frauen zu einer höheren Schmerzsensitivität.[20] Frauen berichten über höhere Angstlevel, die höherem klinischen Schmerz und verstärkten experimentellen Schmerzsensitivität führen.[21] |
| Serotonin: Serotonerge Funktionen werden durch ovariale Hormone moduliert. Beispielsweise ergibt sich eine deutlich erhöhte Serotonin-Synthese bei Patientinnen mit Reizdarmsyndrom. Dabei korreliert die erhöhte Serotonin-Synthese mit einer viszeralen Hypersensitivität. Beim Reizdarmsnydrom besteht eine klare Dominanz des weiblichen Geschlechts.[22] | Depression: Depression und Schmerz sind hoch komorbid, wobei Frauen deutlich häufiger von depressiven Symptomen (v.a. mit somatischem Charakter) berichten als Männer.[23] Zudem scheinen Frauen mit bestimmten chronischen Schmerzen (z. B. onkologischen Schmerzen) eher von Depression betroffen als Männer. |
| NMDA-Rezeptor-Funktionalität: Östrogen trägt zu einer Erhöhung der NMDA-Rezeptor-Erregbarkeit bei. Diese kann dann zur deutlich stärkeren zentralen Sensibilisierung bei Frauen im Vergleich zu Männern beitragen. Die geschlechterbedingte NMDA-Rezeptor-Funktionalität kann helfen das Wind-up-Phänomen bei Schmerz und als Folge zentrale Hypersensitivität oder Hyperalgesie zu erklären.[24] [25] |
Literatur[Bearbeiten]
- Fillingim RB, King CD, Ribeiro-Dasilva MC, Rahim-Williams B, Riley JL. Sex, Gender, and Pain: A Review of Recent Clinical and Experimental Findings. The Journal of Pain 2009; 10(5):447–85.
- Pogatzki-Zahn E. Schmerz und Geschlecht: Deutsche Schmerzgesellschaft e.V.; 2012 [cited 2016 Mar 11]. Available from: URL: http://www.dgss.org/patienteninformationen/besonderheiten-bei-schmerz/schmerz-und-geschlecht/.
- Gerbershagen HJ, Pogatzki-Zahn E, Aduckathil S, Peelen LM, Kappen TH, van Wijck, Albert J M et al. Procedure-specific risk factor analysis for the development of severe postoperative pain. Anesthesiology 2014; 120(5):1237–45.
- Tighe PJ, Riley JL, Fillingim RB. Sex Differences in the Incidence of Severe Pain Events Following Surgery: A Review of 333,000 Pain Scores. Pain Med 2014; 15(8):1390–404.
- Sherman JJ. Does experimental pain response vary across the menstrual cycle?: A methodological review. AJP: Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 2006; 291(2):R245-R256.
- Björkman I, Jakobsson Ung E, Ringström G, Törnblom H, Simrén M. More similarities than differences between men and women with irritable bowel syndrome. Neurogastroenterol. Motil. 2015; 27(6):796–804.
- Henningsen P, Zimmermann T, Sattel H. Medically Unexplained Physical Symptoms, Anxiety, and Depression. Psychosomatic Medicine 2003; 65(4):528–33.
- Payne S. Sex, gender, and irritable bowel syndrome: Making the connections. Gender medicine 2004; 1(1):18–28.
- Gerbershagen HJ, Pogatzki-Zahn E, Aduckathil S, Peelen LM, Kappen TH, van Wijck, Albert J M et al. Procedure-specific risk factor analysis for the development of severe postoperative pain. Anesthesiology 2014; 120(5):1237–45.
- Sherman JJ. Does experimental pain response vary across the menstrual cycle?: A methodological review. AJP: Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 2006; 291(2):R245-R256.
- Sherman JJ. Does experimental pain response vary across the menstrual cycle?: A methodological review. AJP: Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 2006; 291(2):R245-R256.
- Pogatzki-Zahn E. Schmerz und Geschlecht: Deutsche Schmerzgesellschaft e.V.; 2012 [cited 2016 Mar 11]. Available from: URL: http://www.dgss.org/patienteninformationen/besonderheiten-bei-schmerz/schmerz-und-geschlecht/.
- Fillingim RB, King CD, Ribeiro-Dasilva MC, Rahim-Williams B, Riley JL. Sex, Gender, and Pain: A Review of Recent Clinical and Experimental Findings. The Journal of Pain 2009; 10(5):447–85.
- Yarnitsky D, Crispel Y, Eisenberg E, Granovsky Y, Ben-Nun A, Sprecher E et al. Prediction of chronic post-operative pain: Pre-operative DNIC testing identifies patients at risk. Pain 2008; 138(1):22–8.
- Jensen I, Nygren A, Gamberale F, Goldie I, Westerholm P. Coping with long-term musculoskeletal pain and its consequences: Is gender a factor? Pain 1994; 57(2):167–72.
- Keogh E, Eccleston C. Sex differences in adolescent chronic pain and pain-related coping. Pain 2006; 123(3):275–84.
- Lynch AM, Kashikar-Zuck S, Goldschneider KR, Jones BA. Sex and Age Differences in Coping Styles Among Children with Chronic Pain. Journal of Pain and Symptom Management 2007; 33(2):208–16.
- Wood PB. Role of central dopamine in pain and analgesia. Expert Review of Neurotherapeutics 2014; 8(5):781–97.
- Wood PB, Schweinhardt P, Jaeger E, Dagher A, Hakyemez H, Rabiner EA et al. Fibromyalgia patients show an abnormal dopamine response to pain. Eur J Neurosci 2007; 25(12):3576–82.
- Greenspan JD, Craft RM, LeResche L, Arendt-Nielsen L, Berkley KJ, Fillingim RB et al. Studying sex and gender differences in pain and analgesia: A consensus report. Pain 2007; 132:S26-S45.
- Jones A, Zachariae R. Investigation of the interactive effects of gender and psychological factors on pain response. British Journal of Health Psychology 2004; 9(3):405–18.
- Nakai A, Kumakura Y, Boivin M, Rosa P, Diksic M, D'Souza D et al. Sex differences of brain serotonin synthesis in patients with irritable bowel syndrome using alpha-[11C]methyl-L-tryptophan, positron emission tomography and statistical parametric mapping. Canadian journal of gastroenterology = Journal canadien de gastroenterologie 2003; 17(3):191–6.
- Silverstein B. Gender Differences in the Prevalence of Somatic Versus Pure Depression: A Replication. AJP 2002; 159(6):1051–2.
- Fillingim RB, Maixner W, Kincaid S, Silva S. Sex differences in temporal summation but not sensory-discriminative processing of thermal pain. Pain 1998; 75(1):121–7.
- Robinson ME, Wise EA, Gagnon C, Fillingim RB, Price DD. Influences of gender role and anxiety on sex differences in temporal summation of pain. The Journal of Pain 2004; 5(2):77–82.
Die Anzahl neu aufgetretener Krankheitsfälle innerhalb einer definierten Population in einem bestimmten Zeitraum.
Die Häufigkeit einer Krankheit oder eines Symptoms in einer definierten Population zu einem bestimmten Zeitpunkt.
(CMD) Schmerzhafte Fehlregulation des Kauapparates basierend auf psychischen, strukturellen, funktionellen und biochemischen Ursachen.
(RDS) Gastroenterologisches Krankheitsbild, das durch diffuse abdominelle Beschwerden charakterisiert wird und oft auf psychosomatischen Faktoren beruht.
Gelenkentzündungen, die häufig zusammen mit Schmerzen, Schwellungen und Rötungen auftreten.
Multilokuläres, funktionelles Schmerzsyndrom mit typischen schmerzhaften Druckpunkten, aber ohne Hinweise auf einen entzündlichen oder degenerativen Prozess.
(richtig positive Rate eines Tests) bezeichnet den Anteil der test-positiven Personen unter allen Erkrankten einer Stichprobe, d. h. die Wahrscheinlichkeit, mit einem diagnostischen Test die Kranken auch als krank zu identifizieren.
(engl.: to cope with = bewältigen) Bewältigungsverhalten in einer als bedeutsam oder belastend empfundenen Lebenssituationen.
(lat.: deprimere = herunterdrücken) Psychische Erkrankung, die durch die Hauptsymptome gedrückte Stimmung, Verlust an Interessen bzw. an Freude und deutliche Antriebsminderung gekennzeichnet ist.
Biologisches Geschlecht
Soziales Geschlecht